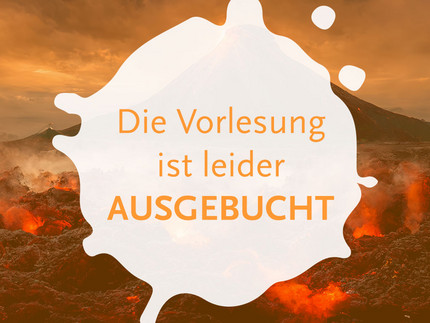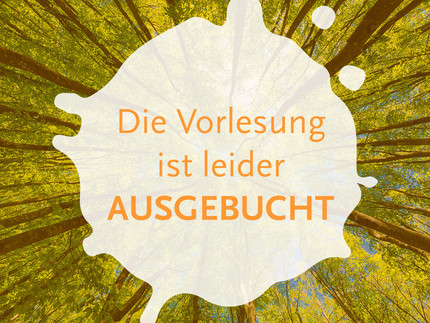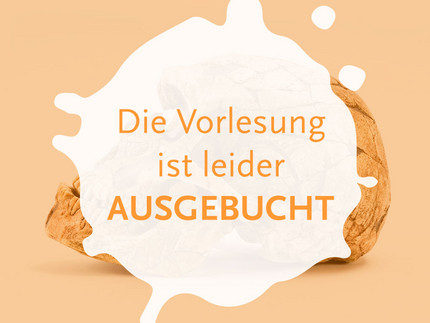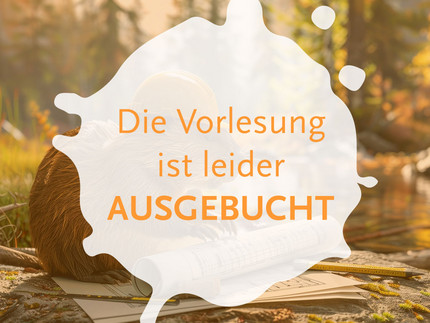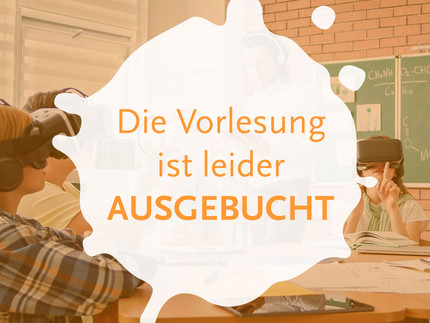Kinder-Uni | Vorlesungsstaffel 1 (9:30 - 10:15 Uhr)
Das sind unsere Referenten und Referentinnen in Staffel 1:
Die Vorlesungen der Staffel 1 sind ausgebucht!
Menschen lieben Süßes – Aber warum eigentlich?
Referent: Prof. Dr. André Kleinridders, Institut für Ernährungswissenschaft / Molekulare und Experimentelle Ernährungsmedizin
Heute können wir fast überall und auch fast immer etwas zu essen bekommen. Besonders Süßigkeiten mit viel Zucker gibt es an jeder Ecke. Das ist eigentlich ganz gut, denn Zucker ist lebenswichtig und auch lecker. Aber oft wissen wir gar nicht, wie viel Zucker wirklich in unserem Essen steckt. Ich werde Euch erzählen, warum wir Menschen so gerne Süßes essen und warum wir das brauchen, aber auch, warum uns zu viel Zucker sogar schaden kann.
Lava, Asche und giftige Gase – Die Geheimnisse der Vulkane
Referenten: Prof. Dr. Eva Eibl / Dr. Sebastian Heimann, Institut für Geowissenschaften / Allgemeine Geophysik
Vulkanausbrüche und Erdbeben gehören zu den faszinierenden und spektakulären geologischen Kräften, die unseren Planeten verändern. Die Erde ist übersät von Vulkanen, in manchen Gegenden liegen sie wie an einer Kette aufgereiht nebeneinander. Während manche Vulkane schon lange inaktiv sind, brechen andere hin und wieder aus, und einige sind sogar ständig aktiv. Wenn Vulkane ausbrechen, können sie Lavaströme, Asche und sogar giftige Gase ausstoßen – nicht selten mit verheerenden Folgen für die unmittelbare Umgebung. Manchmal betreffen die Eruptionen aber auch den ganzen Globus und gefährden zum Beispiel die Land- oder Viehwirtschaft weltweit. In der Vorlesung werde ich erklären und zeigen, warum es zu Vulkanausbrüchen kommt und wieso diese so unterschiedlich sein können.
Schlemmen mit Caesar und Co – Essen und Trinken in der Antike
Referenten: Dr. Eike Faber / Ricardo Rennert, Historisches Institut / Geschichte des Altertums
Was haben Griechinnen und Griechen, Römerinnen und Römer gegessen und getrunken? Wir fangen mit dieser Frage an und schauen, was wir noch herausfinden können! Welche unserer heutigen Lieblingsspeisen haben sie früher nicht gegessen, weil sie am Mittelmeer noch gar nicht bekannt waren? Gab es schon Essen zum Mitnehmen (to go)? Wie lief ein römisches Festmahl ab und wer war dazu eingeladen? Und woher wissen wir das eigentlich, ist ja schließlich alles schon Tausende Jahre her?! In unserer Vorlesung nehmen wir Euch mit auf eine Reise in die Antike, um mit Euch gemeinsam zu entdecken, wie Historiker etwas über frühere Zeiten herausfinden.
Auf Detektivjagd nach Tieren und Pflanzen
Referentin: Prof. Dr. Damaris Zurell, Institut für Biochemie und Biologie / Ökologie / Makroökologie
Um Natur schützen zu können, müssen wir zuerst wissen, wo bestimmte Tiere und Pflanzen leben, wo es ihnen gut geht und wo weniger. Bei 10 Millionen verschiedenen Arten auf der Welt ist das gar nicht so leicht und wir brauchen jede helfende Hand. Vor allem seltene Arten sind sehr schwer zu beobachten – vielleicht, weil sie sich verstecken, im tiefsten Urwald leben oder nur zu ganz bestimmten Zeiten im Jahr zu sehen sind. Forschende müssen also oft richtige Detektivarbeit leisten. Dafür benutzen wir Mikrofone, Kamerafallen, DNA-Spuren und sogar Radar – und große Computer, um alle Spuren auszuwerten. Wie das funktioniert, könnt Ihr in der Vorlesung erfahren und Euch auch selbst als Detektive oder Detektivinnen ausprobieren.
Warum ist die Kuh lila?
Referent: Florian Mehlhase, Betriebswirtschaftslehre / Marketing
Wir alle kennen die Schokolade mit der lila Kuh auf der Verpackung. Aber wer hat sich das ausgedacht – und warum? In dieser Vorlesung erfahrt Ihr, warum Unternehmen ihre Produkte mit Namen und Farben ausstatten und was wir davon haben, wenn wir einkaufen gehen. In Firmen beschäftigt sich vor allem die Marketingabteilung damit, wie die Produkte am besten gestaltet und verpackt werden sollten. Mit Erfolg: Denn obwohl es im Supermarkt wirklich viele Schokoladensorten gibt, haben wir wahrscheinlich alle eine Lieblingsschokolade, die wir immer wieder kaufen. Wir wollen nachforschen, warum das so ist. Und wir möchten mit Euch gemeinsam ein Schokoladen-Experiment durchführen: Mit verbundenen Augen dürft Ihr vier Schokoladensorten verkosten, um zu erraten, welche Marke dahintersteckt. Was glaubt Ihr – könntet Ihr Eure Lieblingsschokolade nur am Geschmack erkennen? Oder kaufen wir sie vielleicht nicht nur, weil sie so gut schmeckt? Wir klären auf!
Knochenjob in Ostafrika – Unterwegs auf den Spuren der ersten Menschen
Referent: Prof. Dr. Martin H. Trauth, Institut für Geowissenschaften / Paläoklimadynamik
Unsere frühen Vorfahren waren vermutlich Afrikaner. Oder doch nicht? Gerade wirbeln neue oder neu untersuchte Knochenfunde unseren Stammbaum durcheinander – wer soll hier denn noch durchblicken? Und was hat das alles mit dem Klima zu tun, mit dem raschen Wechsel von Regen und Dürre, Überflutungskatastrophen und Staubstürmen? Martin Trauth legt für einen Moment den Geologenhammer aus der Hand und versucht, mit Menschenschädeln und Steinwerkzeugen im Gepäck Licht in unsere Vergangenheit zu bringen – in Afrika oder wo auch immer ...
Wer schmatzt denn da? – Fleischfressende Pflanzen aus aller Welt
Referent: Steffen Ramm, Botanischer Garten
Fleischfressende Pflanzen lösen bei vielen Menschen Erstaunen oder sogar Schrecken aus. Bücher und Filme präsentieren oft ein völlig falsches Bild von diesen faszinierenden Lebewesen. Aber wie ist es wirklich: Wie viele fleischfressende Pflanzen gibt es? Was genau „fressen“ diese Pflanzen eigentlich? Und wie machen sie das? Ich bringe Euch die Antworten auf diese und viele weitere Fragen mit.
In der Vorlesung möchte ich Euch außerdem zeigen, dass sie keineswegs gefährliche „Monsterpflanzen“ sind. Durch Fütterungen und kleine Spiele lernt Ihr die fleischfressenden Pflanzen hautnah und sehr genau kennen. Spannend und informativ – der richtige Kurs für Mutige!
Der Biber - ein Landschaftsarchitekt kommt zurück
Referentin: Dr. Stephanie Natho, Institut für Umweltwissenschaften und Geographie / Geographie und Naturrisikenforschung
Der Biber ist ein Säugetier mit kräftigen Zähnen, das Bäume fällen kann. Aus dem Holz baut er Wohnhöhlen oder staut Flüsse mit bis zu vier Meter hohen Dämmen an. Vor 100 Jahren waren die Biber in Deutschland fast ausgerottet, weil Fell und Fleisch begehrt waren. In ganz Europa gab es gerade noch 1200 von ihnen. Durch zahlreiche Wiederansiedlungsprojekte kehrt der Biber inzwischen zurück und erobert die Landschaft – allein in Brandenburg leben derzeit 3700 Tiere. Während er in einigen Regionen durch seine Bautätigkeiten und Auswirkungen auf die Natur willkommen ist, weil er Lebensraum für verschiedenste Arten schafft, gibt es in anderen Regionen große Konflikte zwischen Menschen und Bibern, aber auch zwischen Artenschutz und Bibern!
Wir schauen uns an, wie der Biber die Landschaft verändert und was das für Lebewesen an Land und im Wasser bedeutet. Wir gehen der Frage nach, wie Flüsse und ihre Auen wohl mal ausgesehen haben können in einer Zeit, in der es in Europa 120 Millionen Biber gab – und schauen uns ein Auenmodell an, das mit echtem Wasser geflutet werden kann.
Detektiv*innen aufgepasst – Auf den Spuren des Spracherwerbs
Referentinnen: Prof. Dr. Natalie Boll-Avetisyan, Stella Krüger, MSc. und Dr. Annika Unger, Department Linguistik / Psycholinguistik m.d. Schwerpunkt Spracherwerb
Liebe junge Sprachdetektivinnen und Sprachdetektive, zusammen begeben wir uns auf eine aufregende Spurensuche, um das Geheimnis des Spracherwerbs zu entschlüsseln!
Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie Ihr angefangen habt zu sprechen? Oder warum manche Menschen mehrere Sprachen fließend beherrschen? Lasst uns diese spannenden Fragen gemeinsam erforschen!
Wir werden Beweise dafür sammeln, dass Eure kleinen Sprachdetektiv- Gehirne schon von Beginn an sehr schlau sind. Außerdem werden wir herausfinden, warum Sprache eigentlich so wichtig ist. Zusammen erforschen wir die Besonderheiten des Spracherwerbs und führen sogar einige Experimente durch. Seid Ihr bereit für die Spurensuche?
Alles digital? – Lernen im Klassenzimmer der Zukunft
Referent: Prof. Dr. Steve Nebel, Department Erziehungswissenschaft / Schulbezogene Medienbildung
Die Digitalisierung verändert vieles – auch das Lernen in der Schule: Im Klassenzimmer begrüßt uns ein Roboter und fragt, wie es uns heute geht. Wenn wir eine Aufgabe im Deutschunterricht nicht verstanden haben, bitten wir den Chatbot auf dem Tablet, ob er sie uns noch einmal mit einem guten Beispiel erklären kann. Bruchrechnen lernen wir mithilfe digitaler Spiele. Über das Leben im Mittelalter erfahren wir mehr in der virtuellen Realität. Sieht so die Zukunft des Lernens aus? Im Vortrag erhaltet Ihr einen Eindruck, welche Möglichkeiten digitale Medien für die Gestaltung des Unterrichts bieten. Ihr könnt verschiedene Anwendungen ausprobieren und wir diskutieren mit Euch, was Vorteile, aber auch Nachteile des digitalen Lernens sein können.