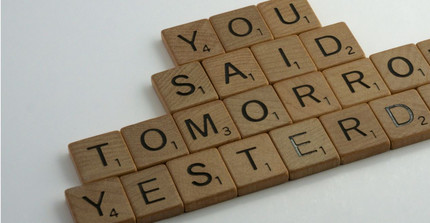Denkwerkstatt schulische Sprachwelten
Denkwerkstatt Schulische Sprachwelten – Flucht, Zuwanderung und Heterogenität
In der Denkwerkstatt „Schulische Sprachwelten – Flucht, Zuwanderung und Heterogenität“, soll ein Werkzeugkasten entstehen, der sichere Kommunikation über Emotionen und kulturelle Normen in deutscher Sprache ermöglicht, um Konflike im schulischen Kontext zu mindern.
Die Denkwerkstatt ist
- eine Miniatur-Denkfabrik für Studierende des Lehramts, Linguistik im Kontext (Schwerpunkt DaF/DaZ), Förderpädagogik Sekundarstufe), Bildungswissenschaften (Sekundarstufe), Inklusionspädagogik (Grundschule), Psychologie (Inklusionspädagogik)
- wurde ins Leben gerufen, um Studierende des Lehramts mit dringend benötigten Skills auszustatten, die über das Curriculum hinausgehen
- ein Ort, an dem Studierende sich austauschen und gegenseitig unterstützen können
- ein Format, in dem konkrete Ideen entwickelt und vorgestellt werden können
Wie funktioniert eine Denkwerkstatt?
- ist für 5 Studierende vorgesehen
- wird über einen Zeitraum von 12 Monaten laufen,
- im Rahmen des Universitätsstipendiums Potsdam (USP) einhergehend mit einer Stipendienzahlung monatlich 300 €
- steht in regelmäßigem Dialog mit den ausgewählten wissenschaftlichen Mitgliedern,
- erfordert eine Arbeitszeit von ca. zwei Stunden pro Woche.
Einstieg in sprachliche Vielfalt: Denkwerkstatt fördert kreative Ansätze für inklusiven Schulunterricht
Auftaktworkshop der Denkwerkstatt "Schulische Sprachwelten – Flucht, Zuwanderung und Heterogenität"
11. Februar 2025
Beim ersten Workshop der Denkwerkstatt "Schulische Sprachwelten – Flucht, Zuwanderung und Heterogenität" kamen engagierte Studierende und Expert*innen zusammen, um innovative Ansätze für die Herausforderungen im schulischen (Sprach)unterricht zu entwickeln. Diese Miniatur-Denkfabrik, die speziell für Studierende des Lehramts, der Linguistik mit Schwerpunkt DaF/DaZ, der Förderpädagogik, der Bildungswissenschaften, der Inklusionspädagogik und der Psychologie konzipiert wurde, zielt darauf ab, Teilnehmende mit dringend benötigten Fähigkeiten auszustatten, die über das traditionelle Curriculum hinausreichen.
Der Auftaktworkshop bot den Teilnehmenden einen Raum, sich kennen zu lernen und sich auszutauschen. In diesem kreativen Umfeld können konkrete Ideen entwickelt und vorgestellt werden, die sowohl die Sprachkompetenzen als auch die sozioemotionale Entwicklung von Schüler*innen fördern. Mit der engagierten Beteiligung und dem Austausch von Erfahrungen und Perspektiven sowohl durch Professor Schröder, Professorin Böhme, Professorin Juang, Miriam Vock, Doktorandin Ewa Sliwinski als auch den Stipendiat*innen untereinander verspricht die Denkwerkstatt, ein wertvoller Beitrag zur Bildungslandschaft zu werden.
Ein zentraler Punkt der Diskussion war, wie Mehrsprachigkeit in der Schule noch stärker normalisiert und positiv genutzt werden kann, besonders in vielfältigen Klassen. Dabei stand die Frage im Fokus, wie Lehrkräfte durch gezielte Unterstützung und innovative Methoden zur Sprachförderung beitragen können, ohne die Vielfalt in der Schülerschaft als Herausforderung, sondern als Chance zu betrachten. Besondere Aufmerksamkeit galt auch der Rolle von Künstlicher Intelligenz und neuen Technologien im Sprachlernprozess. Verschiedene Ansätze wurden vorgestellt, wie KI-Tools das Lernen erleichtern und personalisierte Rückmeldungen für Schüler*innen ermöglichen können. Zudem wurde die Bedeutung der sozioemotionalen Entwicklung der Schüler*innen hervorgehoben, um ein ganzheitliches Bildungsumfeld zu schaffen. Im Rahmen des Workshops planten Studierende und Lehrende in interdisziplinären Projekten weiterzuarbeiten, um praxisorientierte Unterrichtsideen zu entwickeln. Diese Ideen sollen nicht nur die Sprachkompetenzen der Schüler*innen fördern, sondern auch ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten stärken.
Die Denkwerkstatt ist somit nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch der Innovation und der Zusammenarbeit. Die erarbeiteten Konzepte und Lösungsansätze sollen zukünftig die schulische Praxis bereichern und dazu beitragen, ein inklusives und harmonisches Lernumfeld für alle Beteiligten zu schaffen.

Ansprechpartnerin:
Potsdamer Universitätsstipendium
Referentin