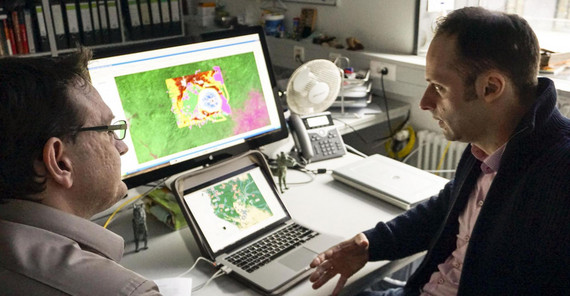Felder, Straßen, Städte, aber auch in Reih und Glied gepflanzte Wälder und schnurgerade Flüsse: Menschen formen die Natur, um sie besser nutzen zu können. Dass der Mensch bereits vor 2.600 Jahren die Ökosysteme Zentralafrikas einschneidend veränderte, hat nun ein Team um den Potsdamer Geoforscher Yannick Garcin herausgefunden. Damit sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Lösung des Rätsels um die sogenannte Regenwald-Krise einen großen Schritt nähergekommen. Sie untersuchten See-Sedimente im südlichen Kamerun und stellten fest, dass nicht klimatische Veränderungen wie extreme Trockenheit oder starke Schwankungen im Niederschlag für den drastischen Wandel des dortigen Ökosystems verantwortlich waren, sondern der Mensch.
Menschen brauchen Raum – zum Siedeln, für die Viehzucht oder die Landwirtschaft. Wächst die Bevölkerung, wird auch mehr Fläche benötigt. Um Flächen für den Ackerbau zu gewinnen, werden Wälder gerodet und Nutzpflanzen ausgesät. So ändert der Mensch das Ökosystem, in dem er lebt. Ein einfacher Zusammenhang, der sich in der Geschichte der Menschheit immer wieder aufzeigen lässt. Eine ähnliche Beziehung besteht zwischen dem Klima und den Ökosystemen. Wandelt sich das Klima, verändern sich die Menge und der Rhythmus der Niederschläge. Weniger Regen bedeutet dann auch, dass sich die Vegetation wandelt, also die Vielfalt und Menge der Pflanzen eines Gebiets. Beide Effekte zeigen also das gleiche Resultat: eine veränderte Vielfalt und Zusammensetzung der Pflanzenwelt einer Region.
Jahrtausendealte Pflanzenpollen geben Aufschluss über die damalige Vegetation
Umweltwissenschaftler können solche historischen Veränderungen der regionalen Vegetation durch unterschiedliche Beobachtungsmethoden sehr gut identifizieren und datieren. So konnte nachgewiesen werden, dass sich vor 3.000 bis 2.000 Jahren ein drastischer Wandel im Ökosystem Regenwald in Zentralafrika ereignet haben muss. Der dichte Urwald wurde vor 2.600 Jahren rasch zu einem Flickenteppich aus Wald und Savanne. Vor etwa 2.000 Jahren entstand dann erneut ein dichter Regenwald in Zentralafrika. Was aber löste diesen plötzlichen Wandel, den Geologen als Regenwald-Krise bezeichnen, aus? Bisher kreiste die Diskussion um die beiden bereits vorgestellten Prozesse, wobei die meisten Forscher eine regionale klimatische Veränderung als wahrscheinlicher ansahen. Als Indizien für diese These galten sogenannte Pollenanalysen. Dabei untersuchen Bio- und Umweltwissenschaftler Pflanzenreste und Samen, die sich in den Sedimenten von Seen finden lassen.
Auch Yannick Garcin nutzte diese Methode. Der Geoforscher, der heute am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften der Universität Potsdam arbeitet, hat sich der Frage verschrieben, wie sich Ökosysteme und Lebensräume entwickeln. Woher rührt sein Interesse für Landschaften, die Jahrtausende oder gar Jahrmillionen alt sind? „Afrika ist für mich ein Teil meiner Heimat. Ich bin in Kamerun und im Senegal aufgewachsen. Ich liebe die Natur und die Menschen, und ich sehe das große Potenzial der Region. Da ist es fast selbstverständlich, mich auch als Forscher um Afrika zu bemühen.“ Besonders beeindruckt hat ihn das komplexe Ökosystem Regenwald. „Hier finden Prozesse statt, die sich auf unterschiedlichste Teilbereiche des Systems Erde beziehen.“
Um Erkenntnisse über die historische Landschaft Zentralafrikas zu gewinnen, untersuchten Garcin und sein Team den Grund des Sees Barombi Mbo im südlichen Kamerun. Denn am Boden von Seen bilden sich Sedimente unter anderem aus Pflanzenpollen, die vom Wind aus den umliegenden Regionen in den See getragen wurden. Aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit in Seen sind diese Ablagerungen kaum verwirbelt und gestört. Es lassen sich sogar jahreszeitliche Veränderungen nachweisen, wodurch das Alter der Sedimente sehr genau bestimmt werden kann.
Wissenschaftler konnten anhand der Pollenanalysen in Sedimenten des Barombi-Sees bereits in den 1980er Jahren zeigen, dass sich das Ökosystem in Zentralafrika vor etwa 2.600 Jahren drastisch änderte. Waren bis dahin kaum Pollen von Savannenpflanzen zu finden, waren sie nun in Sedimenten aus der betroffenen Zeit plötzlich vorherrschend. Da diese Pflanzen mit deutlich weniger Niederschlag auskommen, schien der Hergang der Regenwald-Krise schnell geklärt: Klimatische Veränderungen müssen den Rückgang des Regenwalds bewirkt haben. Doch Yannick Garcin und seine Kollegen sahen das anders. Sie wollten herausfinden, ob der Wandel des Ökosystems nicht auch andere Ursachen haben könnte. Daher konzentrierten sie sich auf die Analyse von pflanzlichen Wachsen. Und tatsächlich bestätigten diese Untersuchungen, dass es eine plötzliche Änderung im Ökosystem rund um den Barombi gegeben haben muss.
Die Forscher untersuchten den Grund des Barombi-Sees in Kamerun
Ein „weißer Fleck“ auf der wissenschaftlichen Landkarte ist der Barombi Mbo, wie er in Kamerun genannt wird, nicht. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben deutsche Forscher die Region um den Barombi besucht und ihn Elefantensee genannt. Damals standen die Flora und Fauna im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses, während Geografen sich darauf beschränkten, den See zu vermessen und dessen Tiefe zu kartieren. Seither hat sich das Selbstbild der Geoforschung stark verändert. „Wir wollen heute das gesamte System Erde analysieren; Wechselwirkungen, kaskadierende Effekte, Beziehungen zwischen Geo- und Biosphäre, dem Klima und den Menschen besser verstehen“, sagt Garcin. Daher sprachen er und seine Kollegen aus Forschungseinrichtungen in Deutschland, Frankreich und Kamerun auch Archäologen und Anthropologen an, um der Lösung des Rätsels um die Regenwald-Krise näherzukommen.
Und tatsächlich zeigen die neuesten Messdaten des internationalen Forscherteams keine Veränderung der Niederschlagsmengen und -rhythmen. Schwankungen der Intensität des Regens in einer Region bedingen wiederum Veränderungen der chemischen Zusammensetzung des Regenwassers. Solche Schwankungen sind in den pflanzlichen Wachsen und langfristig auch in den Sedimenten der Flüsse und Seen nachweisbar. Forscher ermitteln diese mithilfe des Messwerts δD. Wenn also klimatische Veränderungen Grund für die Regenwald-Krise waren, müssten sich auch Veränderungen in δD-Beobachtungen finden. Um hier genauere Daten zu erhalten, vollbrachte Garcin unter anderem mit Unterstützung des Institut de Recherche pour le Développement (IRD) eine logistische Meisterleistung: „Einige Tonnen Material, eine Schwimmplattform und Analyse-Werkzeuge, Stromgeneratoren, Werkzeuge und Computer – fast ein ganzes Laboratorium haben wir an den Barombi verschifft und dort wieder auf- und zusammengebaut“, sagt Garcin. Eine Aufgabe, für die er sich durch das Studium der Erd- und Umweltwissenschaften gut vorbereitet sah. „Als Geoforscher haben wir in den entlegensten Winkeln der Erde zu tun. Da ist eine gute logistische Vorbereitung fast genauso wichtig wie die wissenschaftliche Arbeit.“
Mithilfe der Schwimmplattform war es möglich, Sedimentproben aus unterschiedlichen Bereichen des Sees zu bergen. „Um Proben aus über 100 Metern Tiefe zu erhalten, braucht es spezielle Technik“, erklärt Garcin. Diese an den See zu bringen, dort zusammenzubauen und zu nutzen, wäre aber ohne die Zustimmung der lokalen Bevölkerung nicht möglich gewesen. „Wir haben daher mit den Dorfältesten gesprochen, haben Einheimische als Fahrer, Helfer und Unterstützer angestellt.“ Am Ende konnten die Forscherinnen und Forscher Sedimente in bester Qualität bergen und analysieren. Und tatsächlich bestätigten die gemessenen δD-Daten die Theorie der schwankenden Niederschlagsmengen nicht. Änderungen des regionalen Klimas waren also nicht die Ursache für die Regenwald-Krise – eine andere Erklärung musste gefunden werden.
Menschen rodeten vor 2.600 Jahren den Regenwald Zentralafrikas
„Das ist ein Grundprinzip der Wissenschaft: Als Forscherinnen und Forscher müssen wir Theorien ständig überprüfen“, betont Garcin. „Und stellt sich eine Theorie aufgrund solcher Prüfungen als unhaltbar heraus, dann müssen Forscher eine neue Theorie entwickeln. Diesen Schritt haben wir nun für die Regenwaldkrise initiiert.“ Für diese neue Theorie griffen er und sein Team auf die Expertise ganz anderer Forschungsbereiche zu. In Zusammenarbeit mit den Archäologen und Anthropologen konnten in über 460 archäologischen Funden der Region Indizien für eine neue These gefunden werden. Artefakte des Bantu-Volkes waren bis vor etwa 3.000 Jahren selten. Dagegen finden sich aus der Zeit vor etwa 2.600 Jahren plötzlich weitaus mehr davon. Dies deutet auf einen Anstieg menschlicher Aktivitäten und eine zunehmende Besiedlung der Region hin. Mehr Menschen benötigen aber mehr Nahrung: So gibt es im Seesediment eine große Menge von Pflanzenteilen, die von Nutzpflanzen wie der Perlhirse oder der Ölpalme stammen. Die im Ackerbau erfahrenen Menschen rodeten also den Regenwald, um Anbauflächen zu gewinnen. Dann, am Ende der Regenwald-Krise, verschwinden auch die Samen und Pollen von Nutzpflanzen wieder aus den archäologischen Funden. Der Siedlungsdruck hatte offenbar nachgelassen.
Yannick Garcin vermutet daher, dass nicht klimatische Veränderungen die Regenwald-Krise auslösten, sondern die in der Region siedelnden Menschen Ackerflächen benötigten. Heute ist ein ähnlicher Prozess in weiten Teilen Afrikas, Südamerikas und Asiens zu beobachten. Der Siedlungsdruck, also die wachsende Bevölkerung, zwingt die Menschen, mehr Land urbar zu machen, um Felder zu bestellen. „Wir sehen unsere Studie aber auch als Beweis dafür, dass die Natur die Fähigkeit zur Regeneration besitzt“, unterstreicht Garcin. Sollte sich der Siedlungsdruck abschwächen, könnten die ursprünglichen Ökosysteme neu entstehen. „Ein Freifahrtsschein, um weiter verantwortungslos mit unseren Ressourcen und Ökosystemen umzugehen, ist dies aber nicht“, so Garcin. „Irgendwann ist auch die große Regenerationskraft der Natur erschöpft.“
DIE WISSENSCHAFTLER
Dr. Yannick Garcin studierte Geologie und ist seit 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften der Universität Potsdam.
garcinugeo.uni-potsdampde
Dr. Simon Schneider studierte Geophysik und Kommunikationswissenschaften und arbeitet seit 2015 am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften der Universität Potsdam.
simschneuuni-potsdampde
Text: Simon Schneider
Online gestellt: Alina Grünky
Kontakt zur Online-Redaktion: onlineredaktionuuni-potsdampde